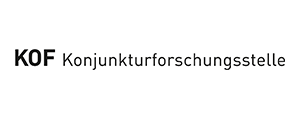Lost Generation – Was können wir gegen die verschärfte Bildungsungleichheit durch die Covid-19 Pandemie tun?
Lost Generation – Was können wir gegen die verschärfte Bildungsungleichheit durch die Covid-19 Pan-demie tun?
von Ann-Kristin Becker und Ina Sieberichs, Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln (iwp)
Im Zuge der Pandemiebekämpfung wurden seit März 2020 die Schulen wiederholt geschlossen. Während Grundschüler:innen soweit möglich in Präsenz oder zumindest im Wechselunterricht beschult wurden, fiel für viele Schüler:innen der höheren Klassen der Präsenzunterricht wochenlang weg.
Elternbefragungen legen nahe, dass sich die Lernzeit der Schüler:innen in Zeiten der Schulschließung halbiert hat. Mehr als die Hälfte der Eltern gab an, dass ihre Kinder während der Schulschließungen weniger als einmal pro Woche online unterrichtet wurden. Die Lernverluste unterscheiden sich dabei je nach Leistungsstärke und Haushaltskontext der Schüler:innen.
Die zunehmende Digitalisierung der Schulen während des ersten Lockdowns hat zwar dazu geführt, dass die Schüler:innen und Lehrer:innen im zweiten Lockdown wesentlich besser in Kontakt standen. Doch auch hier kam es zu einer erheblichen Differenz der Lernzeiten zwischen dem Stand vor und während der Pandemie. Studien über Schulschließungen während der Pandemie zeigen, dass diese zu deutlich schlechteren Ergebnissen in der jährlichen Lernstandserhebung geführt haben.
Die negativen Auswirkungen verringerter Lernzeit sind stärker bei Schüler:innen aus bildungsfernen Haushalten. Sie sind beim Lernen verstärkt auf die Unterstützung von Lehrkräften angewiesen, da ihre Familien ihnen nicht ausreichend beim Lernen helfen können. Die bereits existierende Bildungsungleichheit wurde daher durch die Pandemie noch verschärft und wird voraussichtlich weiter zunehmen. Diese Entwicklung hat langfristige Folgen. Denn schlechtere schulische Leistungen führen in der Regel zu schlechteren Berufschancen und zu einem niedrigeren Lebenseinkommen.
In Hinblick auf die langfristigen volkswirtschaftlichen Schäden ist es von besonderem gesellschaftlichem Interesse, die wachsende Bildungslücke so gut wie möglich zu schließen und Chancengleichheit in der Bildung zu steigern. In diesem Projekt soll eine Maßnahme entwickelt werden, die darauf abzielt, die seit der Covid-19-Pandemie gestiegene Bildungsungleichheit zu reduzieren. Vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse soll abgewogen werden, welche Maßnahme sich aus ökonomischer Perspektive dazu eignet, dieses Ziel zu erfüllen.
- Wie haben sich die pandemiebedingten Schulschließungen auf Bildungschancen von Schüler:innen ausgewirkt?
- Welche Schüler:innen sind am stärksten von den negativen Folgen der Schulschließungen betroffen?
- Welche Maßnahme kann helfen, die steigende Bildungsungleichheit zu reduzieren?
Must-Read Literatur
Kohlrausch, B. (2021): Die Corona-Krise verschärft Bildungsungleichheit. In: WSI-Mitteilungen (06/2021). Online verfügbar unter https://www.wsi.de/data/wsimit_2021_06_kommentar.pdf
Anger, C., & Plünnecke, A. (2021): Schulschließungen: Auswirkungen und Handlungsempfehlungen. In: IW-Kurzbericht (No. 44/2021). Online verfügbar unter https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2021/IW-Kurzbericht_2021-Schulschlie%C3%9Fungen.pdf
Ludgar Wößmann (2020): Folgekosten ausbleibenden Lernens: Was wir über die Corona-bedingten Schulschließungen aus der Forschung lernen können. In: ifo Schnelldienst 73 (Nr. 06), S. 38–44. Online verfügbar unter https://www.ifo.de/DocDL/sd-2020-06-woessmann-corona-schulschliessungen.pdf
Weiterführende Literatur
Anger, C., & Plünnecke, A. (2020): Schulische Bildung zu Zeiten der Corona-Krise. In: Perspektiven der Wirtschaftspolitik 21 (4), S. 353–360. DOI: 10.1515/pwp-2020-0055. Online verfügbar unter https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/pwp-2020-0055/html
Wößmann, L., Freundl, V., Grewenig, E., Lergetporer, P., Werner, K. & Zierow, L. (2020): Bildung in der Coronakrise: Wie haben die Schulkinder die Zeit der Schulschließungen verbracht, und welche Bildungsmaßnahmen befürworten die Deutschen? In: ifo Schnelldienst 73 (Nr. 06), S. 25–39. Online verfügbar unter https://www.ifo.de/DocDL/sd-2020-09-woessmann-etal-bildungsbarometer-corona.pdf
Huebener, M. & Schmitz, L. (2020): Corona-Schulschlieungen: Verlieren leistungsschwächere SchülerInnen den Anschluss? (30). In: DIW aktuell (Nr. 30) Online verfügbar unter http://hdl.handle.net/10419/216975.
Ständige wissenschaftliche Kommission der KMK (2021): Pandemiebedingte Lernrückstände aufholen – Unterstützungsmaßnahmen fokussieren, verknüpfen und evaluieren. Online verfügbar unter https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/KMK/SWK/2021/2021_06_11-Pandemiebedingte-Lernruckstaende-aufholen.pdf
Helbig, M. (2021): Lernrückstände nach Corona – und wie weiter? Anmerkungen zu den aktuell debattierten bildungspolitischen Maßnahmen zur Schließung von Lernlücken. In: Schule und Schulpolitik während der Corona-Pandemie: Nichts gelernt? DDS Die Deutsche Schule Beiheft (Band 18). Online verfügbar unter: https://elibrary.utb.de/doi/book/10.31244/9783830994589
Das Thema wird betreut von
Ann-Kristin Becker
Ann-Kristin Becker ist seit Sommer 2021 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftspolitik beschäftigt. Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Entwicklungsökonomie, Klimapolitik und Wirtschaftsgeschichte.
Nach ihrem Bachelorstudium im Bereich der Angewandten Mathematik (B.Sc.) an der Universität zu Lübeck absolvierte sie ihren Masterstudiengang Economics (M.Sc.) an der Universität zu Köln. Inhaltlich lagen ihre Schwerpunkte in den Bereichen „Statistik und Ökonometrie” und „Wachstum, Arbeitsmärkte und Ungleichheit in der globalen Wirtschaft”. Während ihres Masterstudiums war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) beschäftigt. Nach ihrem Masterabschluss arbeitete sie zunächst als Carlo-Schmid-Stipendiatin und anschließend als Consultant beim United Nations High Comissioner for Refugees (UNHCR) in Genf.

Ina Sieberichs
Ina Sieberichs ist seit 2022 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftspolitik beschäftigt.
Sie forscht schwerpunktmäßig im Bereich der durch die Pandemie veränderten Herausforderungen der Staatsverschuldung, Inflation und Geldpolitik.
Nach ihrem Bachelorstudium in Politik und Wirtschaft (B.A.) an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und der Universidad de Granada in Spanien absolvierte sie ihren Masterstudiengang Economics (M.Sc.) an der Universität zu Köln sowie an der Tel Aviv University in Israel. Inhaltlich lagen ihre Schwerpunkte in den Bereichen „Statistik und Ökonometrie” und „Wachstum, Arbeitsmärkte und Ungleichheit in der globalen Wirtschaft”. Sie sammelte praktische Erfahrung unter anderem als Praktikantin bei der Deutschen Auslandshandelskammer in Lima, Peru, und bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in Bonn und arbeitete in der volkswirtschaftlichen Grundsatzabteilung im Bundesministerium der Finanzen.

















 Anna Straubinger studierte Verkehrswirtschaft mit den Schwerpunkten Verkehrspolitik und Raumwirtschaft an der TU Dresden. Von 2017 bis 2022 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im interdisziplinären Luftfahrtforschungsinstituts Bauhaus Luftfahrt tätig. Währenddessen promovierte sie als externe Doktorandin an der VU Amsterdam zum Thema Passagierdrohnen. Aktuell ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Umwelt-und Klimaökonomik des ZEW und beschäftigt sich mit Fragestellungen rund um nachhaltige Mobilität.
Anna Straubinger studierte Verkehrswirtschaft mit den Schwerpunkten Verkehrspolitik und Raumwirtschaft an der TU Dresden. Von 2017 bis 2022 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im interdisziplinären Luftfahrtforschungsinstituts Bauhaus Luftfahrt tätig. Währenddessen promovierte sie als externe Doktorandin an der VU Amsterdam zum Thema Passagierdrohnen. Aktuell ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Umwelt-und Klimaökonomik des ZEW und beschäftigt sich mit Fragestellungen rund um nachhaltige Mobilität.