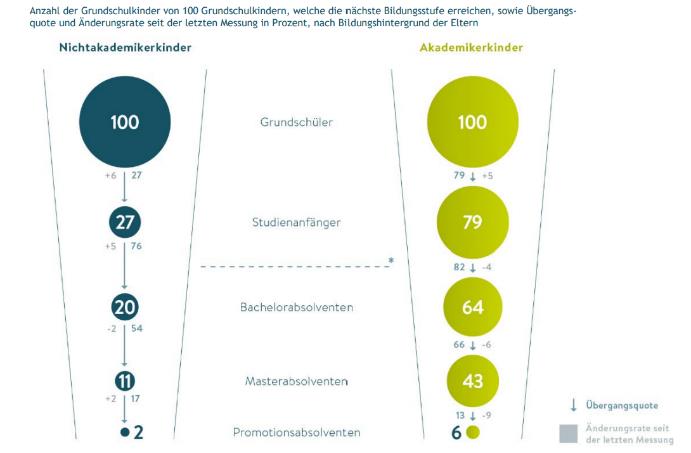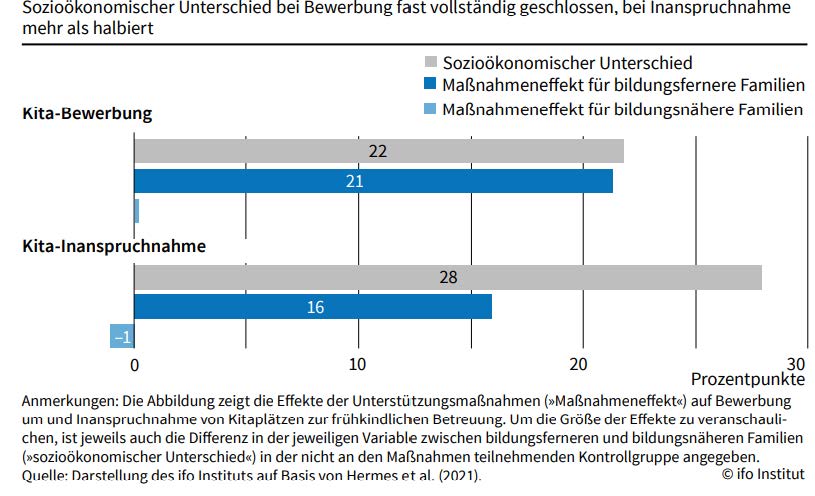Von „Homies“ und „Officegänger*innen“ – Wie sieht die Arbeitskultur der Zukunft aus? (2023)
Von „Homies“ und „Officegänger*innen“ – Wie sieht die Arbeitskultur der Zukunft aus?
von Dr. Nicole Gottschalck, Bucerius Law School
Eigentlich hätte es mit den drei bekannten Megatrends Demografischer Wandel, Fachkräftemangel und Digitalisierung schon genug Wirbel um die Zukunft der Arbeitswelt gegeben. Dann im Jahr 2020 noch die Coronapandemie dazu, die viele Veränderungsprozesse noch beschleunigt hat. Eine der Folgen der Pandemie und der damit einhergehenden Vorgaben und Einschränkungen in der Arbeitswelt ist, dass es heute gibt es eine Reihe von unterschiedlichen möglichen Präsenzkonzepten gibt: Von 100% Home-Office über 2-3 Tage die Woche im Büro bis hin zu 100% Büroalltag ist im Dienstleistungssektor in Deutschland heute (fast) alles möglich. Aber was macht dieser bunte Mix an Präsenz im Büro und Abwesenheit eigentlich mit der Arbeitskultur in einem Unternehmen? Wie schafft man es, Zusammenhalt und Gemeinschaft unter Mitarbeiter*innen zu erzeugen, wenn so unterschiedliche Arbeitszeitmodelle nebeneinander bestehen? Wie schafft man eine gemeinsame Unternehmensidentität und -kultur? Und wie wird man den Bedürfnissen von Arbeitnehmer*innen gerecht, ohne dabei die Wirtschaftlichkeit und damit das Überleben des Unternehmens zu gefährden?
Must-Read Literatur
Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft des BMAS (Hg.) (2021). Arbeitsgesellschaft 2040. Arbeit weiter Denken, Werkheft 05 (https://www.denkfabrik-bmas.de/fileadmin/Downloads/Publikationen/Werkheft_05.pdf)
Weiterführende Literatur
Acar, A., Küper, M., & Wintermann, O. Nachhaltigkeit und Arbeit–Mit digitalen Lösungen analoge Probleme lösen. ZUKUNFT DER ARBEIT, 22.
Hartnell, C. A., Ou, A. Y., & Kinicki, A. (2011). Organizational culture and organizational effectiveness: A meta-analytic investigation of the competing values framework’s theoretical suppositions. The Journal of Applied Psychology, 96(4), 677–694. https://doi.org/10.1037/a0021987
Jurecic, M. (2019). Gut zu wissen: die Wirkung von Büroumgebungen auf unterschiedliche Arbeitstypen. In S. Wörwag & A. Cloots (Hsrg.), Zukunft der Arbeit – Perspektive Mensch. Aktuelle Forschungserkenntnisse und Good Practices. (2. Aufl., S. 331–340). Springer Gabler.
Kugler, P., & Neumüller, K. (2022). Werden wir morgen noch im Büro arbeiten? Erkenntnisse aus dem Covid-19-Lockdown 2020. In Hybride Arbeitsgestaltung (pp. 1-19). Springer Gabler, Wiesbaden.
Schröder, W. (2020). Machtfrage Homeoffice: Mobiles Arbeiten bringt Gewerkschaften in ein Dilemma. WZB Mitteilungen, 170, 27-29.
Pataki-Bittó, F. (2021). Work environment transformation in the post COVID-19 based on work values of the future workforce. Journal of Corporate Real Estate, 23(3), 151-169.
Das Thema wird betreut von

Nicole Gottschalck ist seit September 2020 Juniorprofessorin für Personnel Economics an der WHU – Otto Beisheim School of Management. Gefördert durch die Joachim Herz Stiftung ist sie als WHU Assistant Professor Business mit der Bucerius Law School assoziiert. Sie promovierte am IHK – Lehrstuhl für kleine und mittlere Unternehmen der WHU zum Thema Mitarbeiterbindung in unterschiedlichen Unternehmenskontexten.